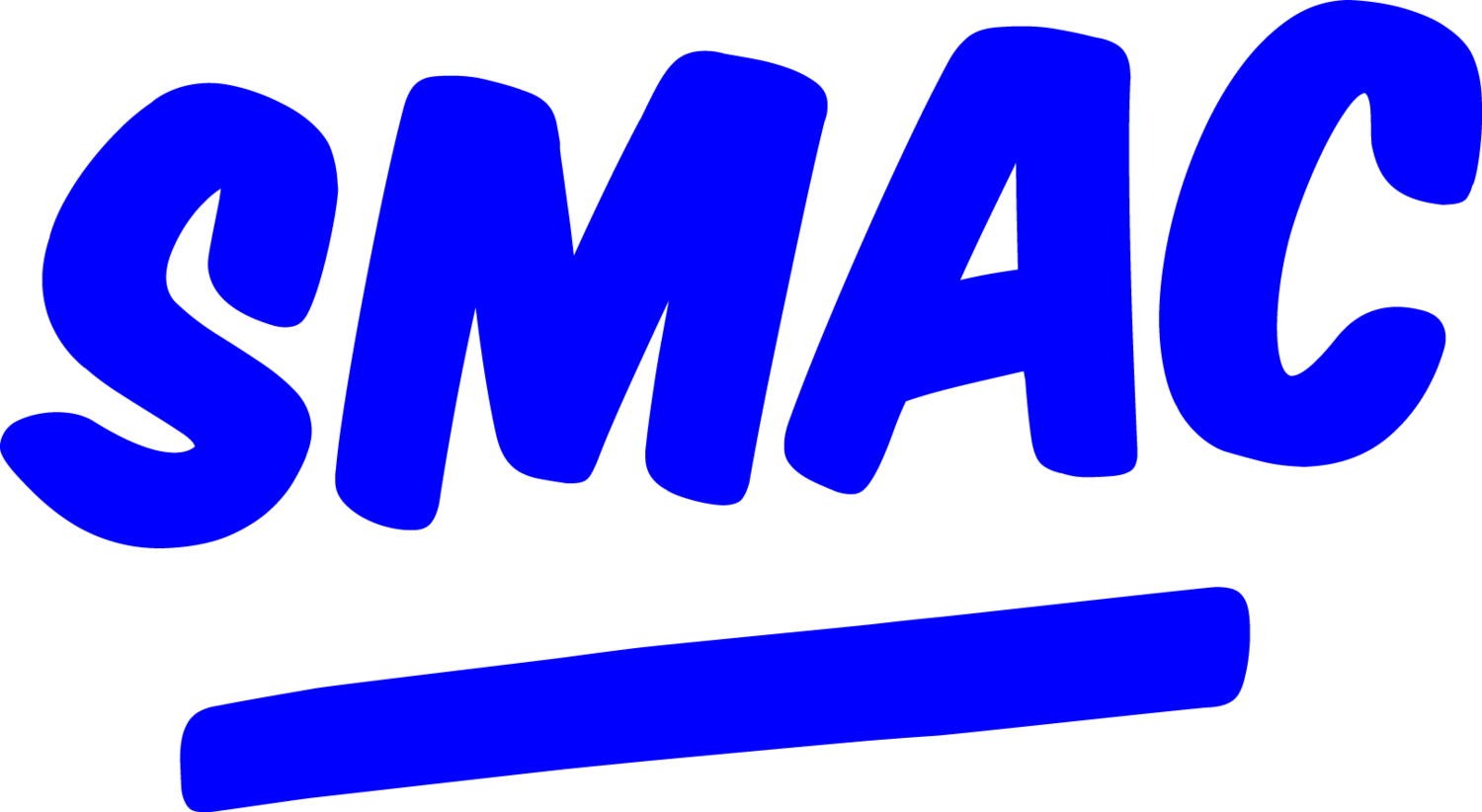Interview mit Karsten Konrad
Er fügt Geschichte neu zusammen: Karsten Konrad ist visueller Archäologe, baut aus Sperrmüll Skulpturen und setzt verschwundener Architektur ein Denkmal. Der 1962 in Würzburg geborene Wahl-Berliner studierte Kunst an verschiedenen Institutionen im In- und Ausland und hinterfragt seither die Wahrnehmung von Raum und Zeit. Ab Donnerstag präsentiert er ausgewählte Werke von "verstörender Eleganz" im Projektraum SMAC. Während der Vorbereitungen zur Ausstellung “Room Service” haben wir ihn in seinem Atelier in Berlin-Mitte getroffen und zum Thema Urbanismus, Utopien und Editionen als Einstiegsdroge befragt.
SMAC: Wie und wann bist Du der Kunst das erste mal begegnet?
Karsten Konrad: Ich habe schon als Kind viel gemalt. Meine Mutter hat auf dem Flohmarkt alte Rahmen gekauft, ich durfte sie füllen. Sie hat mich auch immer mit einbezogen, wenn es um die Einrichtung im Haus ging, zum Beispiel bei der Wahl der passenden Türgriffe. Mit zehn, elf Jahren hatte ich also schon verstanden, dass ästhetische Entscheidungen ihre Wichtigkeit haben können. Ich wollte immer Kunst oder Architektur studieren, die Kunst war allerdings zu jener Zeit von einer sehr realistischen Malweise geprägt. Ich war mir nicht sicher, ob ich so pingelig malen kann. Hat aber geklappt. (lacht)
Wie bist Du von der Malerei zum plastischen Arbeiten gekommen?
Schon während einer Sommerakademie in Salzburg 1984 habe ich Keramikkurse belegt, 1986 dann Stahlbildhauerei in Berlin studiert. So ging das mit dem Stahlschrott los. Während meines Studiums fiel die Mauer und damals wurde viel weggeworfen, der ganze Osten wurde quasi entsorgt. Am Potsdamer Platz gab es einen “Polenmarkt”, wo russisches und polnisches Spielzeug, Nahrungsmittel, Möbel und der ganze Ostkram verkauft wurde. Besonders am Alexanderplatz, wo die meisten Ministerien waren, konnte man alte Teile aus Sitzungsräumen ersteigern, manchmal habe ich sogar Chromteile von stehengelassenen Ostautos abmontiert.
Was hast Du mit dem Schrott gemacht?
Alles genauestens untersucht! Für mich als Westdeutscher war das spannend und im Osten gab es jede Menge Platz für Zwischennutzung, wo ich direkt vor Ort Installationen machen konnte, um Raum und urbane Wahrnehmung zu thematisieren.
Hat die politische Situation damals Deine Arbeit beeinflusst?
Teilweise, ja. Aber als ich noch im Westen lebte, habe ich die DDR sogar noch verteidigt. Ich fand es beispielsweise gut, dass es dort weniger Einkommensunterschiede gab. Dass, das DDR-Regime ein Spitzelsystem war, hat man erst später rausbekommen. Aber der Ostteil Berlins war schöner und nicht so kaputtgebaut wie der Westen. In den Stadtteilen Prenzlauer Berg und in Mitte wurde etwa nie etwas abgerissen. Die westimperialistische Manier alles plattzumachen – als würde man sich dafür schämen und um möglichst schnell an jedem Plattenbau ein kleines Erkerchen anzubringen – das hat mich gestört. Ich fand den die visuellen Überbleibsel der DDR faszinierend und bewahrenswert.
“Oder anders gesagt: Eigentlich gibt es schon alles, ich muss es nur transformieren”
Kann Deine Arbeitsweise mit Fundsachen demnach als Kritik an diesem Prozess gewertet werden?
Einerseits ja, andererseits verbindet mich das einfach mit der Gesellschaft. Ich sehe mich ein bisschen als Archäologe, denn das was die Gesellschaft wegwirft, sagt auch etwas über sie aus. Die Fundsachen reflektieren bestimmte Zeiten, das fängt schon bei den Farbwelten an. So sind die Siebzigerjahre für mich meist ein bestimmtes Orange oder dieses Gelb von Schulmöbeln. Die fünfziger, sechziger Jahre waren im Resopal-Look, Hellblau und Türkis, die Neunziger dann wieder schwarzer Chrom. Mit den Farben und Formen kann ich Dinge zurückverfolgen, gleichzeitig habe ich die Möglichkeit, sie umzuformen. Oder anders gesagt: Eigentlich gibt es schon alles, ich muss es nur transformieren.
Das setzt Du mittlerweile weniger in Form von Installationen um, sondern bist eher bekannt für Deine dynamischen Skulpturen ...
Lange Zeit habe ich sehr architektonisch gearbeitet und beispielsweise aus zerschnittenen und neu zusammengesetzten Spanplatten Mahnmale und Monumente verschwundener Architektur gebaut. „Pool“, die auch im Projektraum SMAC zu sehen sein wird, ist eine Arbeit dieser Zeit. Das Werk ist sozusagen die Spiegelung des heutigen Universal-Gebäudes an der Spree, damals der „Eierspeicher“ (Eierkühlhaus), ein Gebäude mit acht Stockwerken, keinen Fenstern und komischem Ziegelmauerwerk, letzteres wird im heutigen Design des Gebäudes wieder angedeutet. Dort wurden damals ungefähr acht Millionen Eier gelagert. Aus meiner Wohnung am Schlesischen Tor konnte ich die spannende Entwicklung des Gebäudes gut beobachten.
Welche Rolle kommt der Skulptur in der Kunst zu?
Skulpturen sind nochmal was anderes; die sind sperriger, schwieriger, die stehen im Weg. Ich persönlich möchte irritieren, Sehgewohnheiten brechen, vielleicht Erinnerungen wachrufen und mit etwas anderem konterkarieren. Gleichzeitig sollen meine Arbeiten elegant bleiben. Ich will den Trash, den ich sammle, nicht auch noch trashig zusammenballern (lacht) sondern ein verstörendes Angebot machen, attraktiv verpackt.
Du spielst also offensiv mit den Themen Vergangenheit und Erinnerung, gleichzeitig initiierst Du eine augenblickliche Auseinandersetzung mit dem, was uns umgibt. Wie steht es mit der Zukunft — Was bedeutet Utopie für Dich?
Obwohl ich mich nie wirklich aktiv daran orientiert habe, fließen natürlich auch Elemente des Konstruktivismus in meine Arbeit ein. Zum einen die Ablehnung des Figürlichen, insbesondere aber der konstruktivistische Gedanke „Wir bauen eine neue Gesellschaft und somit auch eine neue Kunst“. Ich habe zwei Jahre Architektur und Stadtforschung beim Architekten Arno Brandlhuber studiert, der sehr utopische Ansätze verfolgt. Ich selbst habe bestimmte Vorstellungen davon, wie eine Stadt sein sollte und beobachte immer wieder, dass sich vieles nicht unbedingt in die richtige Richtung entwickelt. Zum Beispiel der explosive Wohnraum in Mitte oder der starke Autoverkehr – meine Utopien sehen anders aus.
“Nicht jede Arbeit ist eine Anklage an den fehlgeleiteten Urbanismus in Berlin”
Kannst Du ein Beispiel geben?
Der Wohnraum, den wir brauchen, kann nur auf eine unorthodoxe Art und Weise geschaffen werden. Zum Beispiel müsste man auf bestehende Dächer draufbauen. Aber sehr veraltete, strikte Bauordnungen engen die Architektur ein. Das sind Themen, die mich interessieren, ohne dass ich das jetzt immer ausgesprochen als Skulptur formuliere. Zum Beispiel die Arbeit für die „Room Service“-Ausstellung: SMAC ist ein sehr schöner, zurückgezogener Ort, da möchte ich einfach nur die Außenwelt Stadt in Form von einem poppigen Materialbild reinbringen. Nicht jede Arbeit ist eine Anklage an den fehlgeleiteten Urbanismus in Berlin.
Was steckt noch hinter dem Konzept für die Ausstellung bei SMAC?
Der Titel “Room Service” soll bedeuten: Dem Raum einen Dienst erweisen. Ich will mittels der Arbeiten, die ich dort zeige, den Raum verändern. Ich möchte in diesen cleanen,Space im Hinterhof ein bisschen “was reinballern”. Der Titel der großen Arbeit, “Superfly”, spielt auf den Song von Curtis Mayfield an und damit auf einer meiner prägendsten Kindheitserinnerungen: Die amerikanischen Fernsehserien der siebziger Jahre, das Knallige und Bunte, die Einstellung des “alles geht.” Im Vergleich zu den Sechzigern hatte sich in den Siebzigern einiges getan – vielleicht findet sich hier die Utopie. Eine, die sich zwar überhaupt nicht eingelöst hat, mir als Kind im spießigen, eingeengten Westdeutschland jedoch die große Welt der Form und der Musik, der Liebe und der Freiheit gezeigt hat.
Mit dem Verweis auf frühere Utopien formulierst Du also Deine eigene Vision?
Wahrscheinlich haben wir alle eine Utopie in uns. Ich mache mir nicht so große Hoffnungen für den Planeten oder den Großteil der Menschen.
Brauchen wir dann nicht umso mehr eine Utopie?
Viele Menschen verfolgen ähnliche soziale und planetenfreundliche Utopien, an dessen Schnittstellen man sich treffen kann. Es gibt allerlei Möglichkeiten dafür, etwas Gutes zu tun. Letztendlich muss das nur gebündelt und besser vernetzt werden. Vielleicht werden deswegen Menschen Künstler, um mit anderen verbunden zu sein, die ähnliche Ideen haben. Zum Beispiel der Gedanke, dass es nicht primär ums Geld geht. Andererseits kauft am Ende vielleicht irgendein reicher Idiot deine Arbeit.
Was steckt hinter der Idee eine Edition herauszubringen?
Ich finde das Konzept mit kleinen Arbeiten, die weniger kosten, einen demokratischen Gedanken – eine Art Einstiegsdroge zum Kunst sammeln. Aber wenn man die ganzen Ambivalenzen der Kunstwelt aufdröselt, wäre die Utopie wohl weg. (lacht) Irgendwas muss da jedoch drinstecken, sonst würde man nicht weitermachen. Letztendlich gilt doch: Was will man mehr, als die Leute zu berühren und zum nachdenken zu bringen?
Interview: Leonie Haenchen
Photos: Daniel Farò